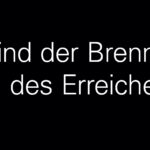Steffen Weber ist seit fast zehn Jahren Mitglied der HR-Big Band. Der gebürtige Mosbacher studierte Saxofon an der Musikhochschule Mannheim und wurde später dort, und an der Hochschule in Mainz, selbst Dozent. Wir sprachen mit ihm über das Üben.
Als Saxofonist in der HR-Big Band sind deine Wochen bereits weit im Voraus durchorganisiert. Kannst du uns mitnehmen in einen typischen Arbeitsalltag? Wie schaffst du es darin dein persönliches Üben unterzubringen?
Da ich in Weinheim wohne und die Big Band in Frankfurt probt, fahre ich dort morgens erst einmal mit dem Zug nach Frankfurt. Wir proben in der Regel bis circa 14.30 Uhr, bevor es dann wieder zurück nach Hause geht. Dort ist dann zunächst Hausaufgaben machen mit meinen beiden Kindern angesagt. Nach dem Abendessen übe ich dann.
Das klingt nach früh aufstehen und spät zu Bett gehen?
Im Prinzip ja. Während der Dienstzeit hat man bereits mehr als vier Stunden gespielt. Das heißt, nachmittags und abends finden bei uns keine Ansatzübungen mehr statt. Man übt dann Dinge, die einen musikalisch weiterbringen – also improvisatorisch. Für mich heißt das, dass ich abends nicht mehr lange Töne spiele, sondern Sachen übe, die Spaß machen und weswegen ich eigentlich auch Musik mache. Töne-Aushalten machen Saxofonisten sowieso nicht ganz so viel wie andere Bläser. (lacht)
Übst du dann eher in mehreren kleinen Übe-Einheiten oder lieber in einer längeren am Stück? Und warum?
Meine Einheiten dauern meistens 45 Minuten. Allerdings auch nicht mit der Stechuhr. Es passiert durchaus mal, dass es nur eine halbe Stunde ist. Oder eben eine Stunde. Und es ist natürlich nicht so, dass ich die ganze Zeit über voll konzentriert bin. Das geht auch gar nicht.
Bei mir heißt üben, dass ich dann Sachen mache, die mein geistiges Dasein fördern und be-nötigen und die sich mit Übungen abwechseln, die im Autopilot laufen. Insgesamt komme ich damit auf die erwähnten 45 Minuten, mache dann eine kleine Pause und anschließend das Gleiche nochmal. Meist ist der Tag danach auch schon vorbei. Mehr als zwei Stunden üben ist bei mir, im Normalfall, nach dem Dienst nicht mehr drin.
Wie schaffst du es dabei, dein Üben langfristig zu strukturieren?
Ich hatte immer schon drei Kategorien von Zielen: kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele.
Kurzfristige Ziele sind für mich Auftritte, die demnächst anstehen. Wenn ich zum Beispiel irgendwo gespielt habe und musste mir dafür Noten anschauen oder Changes, über die ich noch nicht gescheit spielen konnte. Auch Stellen in den Nebeninstrumenten Flöte und Klarinette fallen hier hinein. Beim Konzert ist es ja immer so: Du hast eine Chance und wenn die Stelle dann nicht geklappt hat, ist die Chance vorbei. Dann gibt’s zwar beim nächsten Konzert wieder eine Chance, aber für dieses Mal war’s dann halt nichts.
Aus den langfristigen Zielen ergeben sich die mittelfristigen Ziele. Die langfristigen Ziele sind für mich Dinge, die ich “in einem halben Jahr/ in einem Jahr oder sogar noch später” können will. Das wäre zum Beispiel bestimmte Stücke in allen Tonarten beherrschen. Das ist nichts, das man in einem Monat wirklich “können kann”. Manche Dinge benötigen einfach etwas mehr Zeit. Auch Intonation beispielsweise. Überhaupt Gehörbildung: Die kann man sich nicht kurzfristig erarbeiten.
Die mittelfristigen Ziele sind dann die Dinge, die ich mache, um die langfristigen zu erreichen. Gesetzt den Fall, ich möchte ein bestimmtes Stück in allen Tonarten üben und ich merke, da ist eine Verbindung drin, die ich nicht in allen Tonarten spielen kann – weil ich sie nicht höre oder nicht verstehe – dann muss ich eventuell erst diese kleine Verbindung in allen Tonarten üben. Das sind dann Übungen, die ich täglich mache – wobei die kurzfristigen Ziele natürlich ein bisschen Vorrang haben – und ich erreiche damit sukzessive meine langfristigen.
Das Üben ist, seit ich Familie habe, deutlich anders. Es muss gar nicht zwangsläufig weniger werden, aber es verändert sich von der Strukturierung. Ich bin früher, während des Studiums in Mannheim, oft schon ganz früh zur Hochschule gegangen und war dann dort den ganzen Tag. Natürlich hat man sich zwischdurch auch mal mit den Kollegen getroffen und einen Kaffee getrunken und etwas zu Mittag gegessen. Aber da man nicht viele Verpflichtungen hatte, war man viel freier. Man konnte den ganzen Tag in der Hochschule üben. Heute heißt es: “Jetzt habe ich zwei Stunden Zeit – jetzt muss ich üben.” Und wenn man diese Zeit dann vertrödelt oder selbst nur eine Stunde davon Quatsch macht, bleibt nur noch eine Stunde übrig.
Du warst auch eine Zeit lang Dozent in Mannheim und in Mainz. Würdest du sagen, dass sich durch die Arbeit mit den Studierenden und das Verbalisieren bestimmter Probleme dein Üben ebenfalls nochmals verändert hat?
Ja, mit Sicherheit. Ich finde immer, wenn man anderen hört – egal ob auf CD, live oder beim Unterrichten – dann lernt man daraus. Auch als Lehrer. Letzten Endes gibt kein Universalrezept. Das ist immer der falsche Ansatz. Man sollte immer individuell auf die Leute eingehen. Das ist auch die große Herausforderung beim Unterrichten. Selbst der beste Lehrer kann einem nicht die besten Tipps geben. Ich glaube der beste Lehrer ist man immer selbst.
War das Unterrichten auch ausschlaggebend für deine App?
Naja, irgendwie schon. Der Hauptgrund hingegen war jedoch kein musikalischer. Mein großer Sohn hatte angefangen, mir YouTube-Videos zu zeigen, wie man den Apple-Taschenrechner programmiert. Ich hatte mich dann wahnsinnig gefreut, dass er sich fürs Programmieren interessiert und wollte das unterstützen. Daraufhin habe ich mir ein Buch gekauft. Mit dem habe ich dann selbst sofort angefangen zu lernen. Nach zwei Wochen ließ sein Interesse jedoch wieder nach. Ich wollte ihm aber zumindest zeigen, dass, wenn man etwas beginnt, es auch zu Ende machen sollte. Daraufhin begann ich zu überlegen, was ich machen könnte. Ich hatte überall Zettel mit Notizen zum Üben verteilt – Fingersätze, Übungen für Vierteltöne, »False Fingering« und so weiter. Ich wollte diese gebündelt in einer App zusammenfassen und entwickelte ein Konzept. Die Liste wurde immer länger und es gab immer mehr Ideen, bis letztlich die App im App-Store war – das war jedoch nicht geplant. (lacht)
Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren “Erstsemester-Musikstudenten-Ich” mitgeben? Über welchen Tipp wärst du damals froh gewesen?
“Steter Tropfen höhlt den Stein.” Man sieht den Mount Everest vor sich, der immer höher wird. Der Punkt ist jedoch, einfach loszulaufen. Weil man merkt, dass man sowieso niemals oben ankommt. Je höher man läuft, desto höher wird auch der Berg. Am Anfang weiß man ja gar nicht, was man nicht kann. Das wusste Coltrane auch nicht. Das wusste kein großer Musiker. Das ist auch gar nicht schlimm. Mach’s einfach! Geh einfach immer weiter und üb einfach immer weiter und erfreu dich daran, dass du immer besser wirst. Ich glaube diejenigen, die immer weiter gehen – vor allem über Jahre und Jahrzehnte, die haben am Ende auch Erfolg.

Der Podcast “Wie übt eigentlich?”
Patrick Hinsberger studierte Jazz-Trompete an der Hochschule der Künste in Bern. In seiner Podcast-Reihe “Wie übt eigentlich..?” spricht er einmal im Monat mit Musikerinnen und Musikern aller Genres über das Intimste und Geheimnisvollste in ihrem Alltag: das Üben. Die Folgen kann man auf allen bekannten Streamingdiensten, wie Spotify, Apple Podcast & Co., kostenlos anhören.